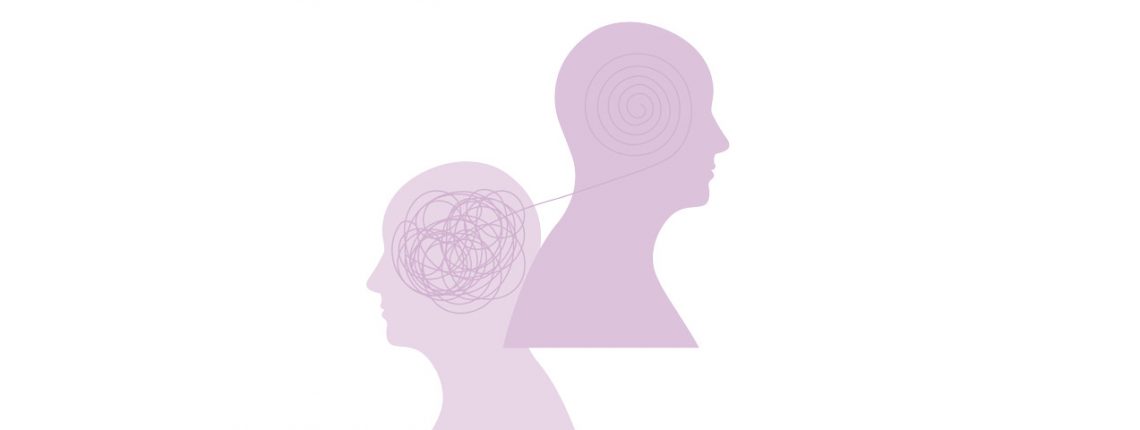
Neurowissenschaften Wenn Empathie zu Stress wird
Empathie hilft dabei, sich anderen Menschen nahe zu fühlen und kann so vor psychischer Belastung schützen. Aber was passiert, wenn sie selbst zur Belastung wird? Ein Blick auf unser Gehirn gibt Aufschluss darüber
Ich bin nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Psychotherapeutin. Das bedeutet: Einen Teil meiner Arbeitswoche verbringe ich damit, hauptsächlich zuzuhören. In dieser Zeit sitze ich nicht am Computer, analysiere Daten oder manage Projekte. Zu meiner psychotherapeutischen Arbeit gehört es, empathisch zu sein. Ich fühle mich in die Geschichten von zutiefst menschlichem Leid und manchmal auch Glück ein.
Manchmal bin ich nach so einem Tag ausgelaugt und spüre, dass meine Fähigkeit zur Empathie erschöpft ist. Tatsächlich gibt es den Zustand der „Empathic Distress Fatigue“. Die empathische Belastungserschöpfung beschreibt eine Art Müdigkeit oder Stress durch „zu viel“ Empathie.
Wie genau führt Empathie zu Stress? Um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, Empathie genauer zu verstehen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Begriff Empathie sehr genau definiert. Er meint, dass Menschen sich in andere einfühlen und so deren Gefühle teilen können, wohlwissend, dass das Gefühl von der anderen Person stammt. Üblicherweise wird Empathie als positive und wichtige Eigenschaft für unser soziales Miteinander betrachtet. Sie ermöglicht gegenseitiges Verständnis, das Knüpfen und die Aufrechterhaltung von Freundschaften, elterliche Fürsorge und fördert kooperatives Verhalten. Empathie ist somit eine wichtige Grundlage für menschliche Kommunikation und hängt mit psychischem Wohlbefinden zusammen.

Doch Empathie hat manchmal auch negative Folgen für unsere mentale Gesundheit. Emotional mitzuschwingen, bedeutet nämlich, sowohl Freude als auch Leid zu teilen. Wenn ich Patient:innen gegenübersitze, die Schmerz empfinden, spüre ich selbst bis zu einem gewissen Grad ebenfalls Schmerz. Wir können dieses Phänomen sogar im Gehirn nachweisen. Wenn wir den Schmerz bei einer anderen Person beobachten, sind bei uns im Gehirn ähnliche Regionen aktiv, die auch bei eigenem Schmerz eine Rolle spielen. Das Gehirn unterscheidet dementsprechend nicht eindeutig zwischen fremdem und eigenem Schmerz.
Negative Gefühle sind Teil menschlichen Erlebens und führen noch nicht zwangsläufig zu psychischer Belastung. Unter welchen Umständen also hat Empathie längerfristige negative Konsequenzen? Tatsächlich gibt es über den Zusammenhang von Empathie und psychischer Belastung einige Hypothesen. Eine davon beschreibt einen U-förmigen Zusammenhang. Das bedeutet, dass sowohl sehr wenig als auch sehr viel Empathie mit höherer Belastung verbunden ist, während ein mittleres Maß an Empathie mit geringer Belastung einhergeht. Diese Hypothese ist bisher nur unzureichend erforscht. So fehlen insbesondere zuverlässige Daten zu den neuronalen Reaktionen im Gehirn auf Empathie. Denn viele Arbeiten beruhen auf Fragebögen von Proband:innen, die ihre Empathie selbst einschätzen. Solche Selbsteinschätzungen können jedoch subjektiv verfärbt sein.
Im Rahmen unserer Arbeit haben wir deshalb zusätzlich Gehirnaktivität gemessen, während Menschen Empathie empfinden. Hierzu zeigten wir über 300 Proband:innen im Magnetresonanztomografen kurze Videos von Personen, die negative oder neutrale Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Unsere Testpersonen sollten sich dabei, so gut wie möglich, einfühlen. Wir analysierten dann, welche Gehirnregionen bei negativen Videos stärker aktiv sind als bei neutralen Videos. Nach jedem Video wurden die Proband:innen außerdem nach ihrer Stimmung gefragt. Eine eher negative Stimmung nach solchen negativen Geschichten deutet dabei auf stärkere Empathie hin.
Die der Empathie zugrunde liegende neuronale Aktivität brachten wir schließlich in Zusammenhang mit dem berichteten Stressempfinden während der letzten Wochen. Dabei berücksichtigten wir zusätzlich die individuell unterschiedliche Neigung zum Grübeln. Denn es gibt Hinweise darauf, dass sich Empathie und psychische Belastung nicht unmittelbar bedingen, sondern auch von anderen Faktoren beeinflusst sind. Dazu gehören negative Denkprozesse wie das Grübeln – also die Tendenz, sich auf (negative) Gedanken zu fokussieren. Die Annahme ist: Wer sich in das Leid anderer einfühlt und sich tendenziell in negativen Gedanken verstrickt, ist anfälliger für psychischen Stress.
Tatsächlich konnten wir in unserer Studie genau diesen U-förmigen Zusammenhang zwischen empathiebezogener Gehirnaktivität und Stress nachweisen – aber nur bei Personen, die überdurchschnittlich viel grübelten. Außerdem zeigte sich der Zusammenhang nur in einem spezifischen Gehirnareal – der Inselrinde. Sie ist ein Teil der Großhirnrinde, der äußeren Schicht des Gehirns, und wird – eben wie eine Insel – von Stirn-, Schläfen- und Scheitellappen umgeben. Die Inselrinde ist eine Gehirnstruktur, die äußere und innere Sinneseindrücke integriert, und spielt damit auch bei der Verarbeitung von Empathie eine entscheidende Rolle.
Anders gesagt: Wenig Inselaktivität (wenig Empathie) plus Grübeln kann bedeuten, dass Menschen sich emotional weniger verbunden fühlen und deshalb mehr Stress empfinden. Sie erleben sich möglicherweise emotional abgekühlt. Diese Interpretation bleibt allerdings spekulativ, denn der Zusammenhang zwischen geringer Empathie und höherer Belastung lässt sich nicht so einfach in den Fragebogenergebnissen wiederfinden. Eine hohe Inselaktivität (viel Empathie) plus Grübeln deutet darauf hin, dass Menschen negative Gefühle aufsaugen wie ein Schwamm. Ihnen fällt es womöglich schwer, sich abzugrenzen – was ebenfalls Stress auslösen kann. Zu viel Empathie kann demnach ausbrennen und zu Stress führen. Dieser Zusammenhang zeigt sich in unseren Daten jedoch nicht bei den Menschen, die generell wenig grübeln. Eine größere Neigung zum Grübeln scheint also das Risiko psychischer Belastung durch Empathie zu erhöhen.
Besonders Personen im Gesundheitswesen, die täglich mit menschlichem Leid konfrontiert sind, könnten von Präventionsmaßnahmen gegen „Empathic Distress Fatigue“ profitieren. Abgrenzungsstrategien und ein flexibler Umgang mit Empathie könnten helfen, die psychische Gesundheit zu fördern. Auf der anderen Seite könnten Menschen, die sich wenig in andere einfühlen, Empathie und vor allem Mitgefühl gezielt trainieren und so emotionale Nähe herstellen.
Für meine Forschung ist dieses Ergebnis der Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen. Angesichts aktueller globaler Krisen, Umweltkatastrophen und Kriegen sind wir häufig direkt oder indirekt über Nachrichten und soziale Medien mit menschlichem Leid konfrontiert. Auch hier scheint Empathie eine zentrale Rolle zu spielen. Selbst wenn Personen nicht unmittelbar betroffen sind, können sie dennoch durch das Beobachten von traumatischen Ereignissen psychische Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln. In meiner aktuellen Studie untersuche ich deshalb, ob empathische Menschen anfälliger für solche Symptome sind.
Auch für meine psychotherapeutische Arbeit bleibt das Thema relevant. Um Stress durch Empathie zu verringern, ist es wichtig, dass auch ich die Balance finde zwischen Einfühlen und Abgrenzen. Wenn ich die Praxis verlasse, versuche ich deshalb, nicht über all das Leid nachzugrübeln, sondern fokussiere mich auf meine Freizeit: den Wind im Gesicht, wenn ich mit dem Rad fahre, das Abendessen mit Freund:innen, oder den Roman, der zu Hause auf mich wartet.
Zum Thema
Zwei Seiten einer Medaille
Empathie ist (noch kein) Mitgefühl
Empathie bedeutet, dass wir spüren, wenn ein anderer Mensch Freude, Trauer oder Schmerz empfindet. Wir können uns in seine Lage hineinversetzen. Doch Empathie hat auch eine Schattenseite: Wenn wir das Leid anderer zu sehr zu unserem eigenen machen, kann das zu empathischem Stress führen, einer Form von Überforderung, die Rückzug oder sogar Hilflosigkeit auslöst. In solchen Momenten fühlen wir mit, sind aber nicht immer in der Lage, wirklich zu helfen.
Hier setzt das Mitgefühl an, das über das bloße Miterleben hinausgeht. Es verbindet Empathie mit dem Wunsch, aktiv zu helfen. Anstatt uns in der Belastung des anderen zu verlieren, richtet Mitgefühl unsere Energie nach außen. Während Empathie die Tür zu den Gefühlen anderer öffnet, sorgt Mitgefühl dafür, dass wir diese Verbindung konstruktiv nutzen.
Forschende konnten zeigen, dass Empathie und Mitgefühl im Gehirn unterschiedlich verankert sind. Empathie für das Leid anderer aktiviert demnach unter anderem Regionen, die bei eigenem Schmerz anspringen. Mitgefühl hingegen wirkt eher auf Bereiche, die mit Fürsorge und positiven Emotionen verbunden sind. Dadurch entsteht nicht Erschöpfung, sondern innere Stärke.
Empathie und Mitgefühl lassen sich übrigens bis ins hohe Alter noch erlernen, etwa im Rahmen des „Cognitively-Based Compassion Training“. Dabei schulen Teilnehmende ihre eigene Aufmerksamkeit, üben, sich in die Lage anderer Menschen hineinzuversetzen, und bauen positive Gefühle wie Freundlichkeit und Fürsorge auf. Studien ergaben, dass viele Teilnehmende nach rund acht Wochen in der Lage sind, die Gefühle anderer Menschen besser wahrzunehmen. Und das zeigt sich auch im Gehirn, wo die Aktivität in Regionen ansteigt, die mit Belohnungsverarbeitung verknüpft sind – es spiegelt das gute Gefühl, das mit Fürsorge und sozialem Handeln verknüpft ist. — J. Schüring

