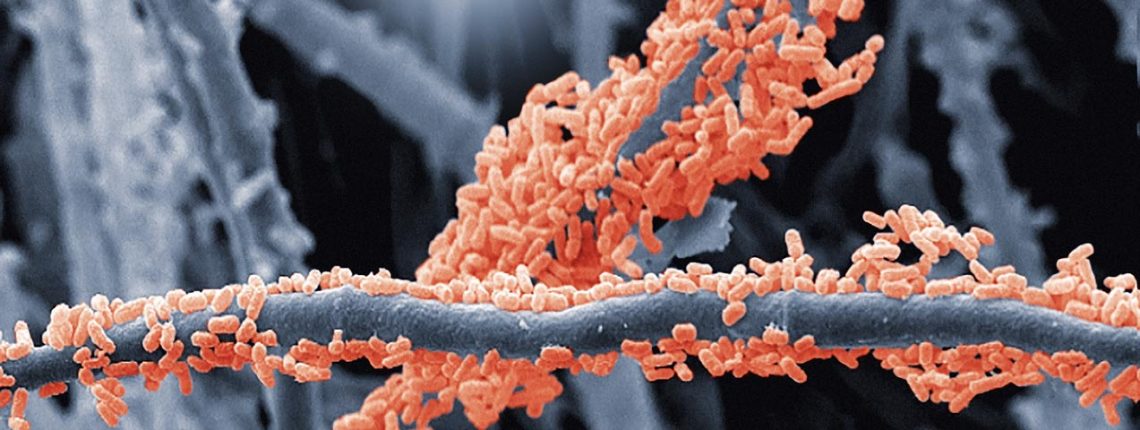
Biologie Eine starke Allianz
Die Sanierung alter Industriestandorte, Müllkippen und Tankstellen ist aufwändig und teuer. Dabei gibt es im Untergrund bereits eine Arbeitsgemeinschaft, die Schadstoffe unschädlich machen kann. Eine Geschichte von Pilzen und Bakterien
Glyphosat ist momentan ja irgendwie in aller Munde. Der Unkrautvernichter, der seit den 1970er Jahren weltweit in Gebrauch ist, lässt sich in vielen Nahrungsmitteln nachweisen und steht im Verdacht, Krebs auszulösen. Doch Glyphosat ist nur eine von unzähligen chemischen Substanzen, die durch uns Menschen in die Böden gelangen, wo sie von Pflanzen aufgenommen werden oder ins Grundwasser gelangen können. Neben Substanzen aus der Landwirtschaft sind dies insbesondere organische Schadstoffe wie Öle oder Lösemittel aus Tankstellen, Industriestandorten oder alten Deponien. Derzeit gibt es in Deutschland mehr als 260.000 als „Altlast“ verdächtigte Flächen.
Als Schadstoffe gelten Substanzen erst dann, wenn sie aufgrund ihrer Eigenschaften ab einer bestimmten Konzentration für Menschen, Tiere oder Pflanzen schädlich sind. Nur: Bei einem Großteil der heute verwendeten über 100.000 Chemikalien weiß man über deren Gefährlichkeit nichts. Gesundheitliche oder ökotoxikologische Gefährdungsbeurteilungen wurden nie vorgenommen. Gewiss ist aber: In unseren Körpern lassen sich mittlerweile mehr als 300 chemische Substanzen nachweisen, die dort eigentlich nicht hingehören. Das zeigt, wie wichtig saubere Böden sind, denn hier wächst das Getreide und weidet das Vieh.
Dass die Folgen des anhaltenden Chemikalieneintrags oft erst Jahre oder Jahrzehnte später zu spüren sind, liegt an den besonderen Eigenschaften des Bodens. Er bindet die Stoffe chemisch oder physikalisch – und zwar so lange, bis die Speicherkapazität für die jeweiligen Substanzen erschöpft ist. Zum anderen ist der Boden aber auch Lebensraum für Myriaden von Mikroorganismen, die sich von organischen Substanzen ernähren. Diese können natürlichen, aber auch nicht-natürlichen Ursprungs sein. Kurzum: Manche Schadstoffe werden im Lauf der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes gefressen.
Allerdings sind die Schadstoffe im Boden ungleichmäßig verteilt und die Bakterien müssen sich erstmal den Weg zu ihnen bahnen. Die meisten verfügen über dünne, schraubenförmig gewundene Geißeln, die die wenige tausendstel Millimeter großen Organismen antreiben – auf diese Weise schaffen sie durchaus Wegstrecken von einigen Metern pro Tag. Schon der Urvater der Mikroskopie, Antoni van Leeuwenhoek, konnte das Treiben der Bakterien beobachten und beschrieb 1676 das „Umherwimmeln kleiner Kreaturen“ in einem Wassertropfen.
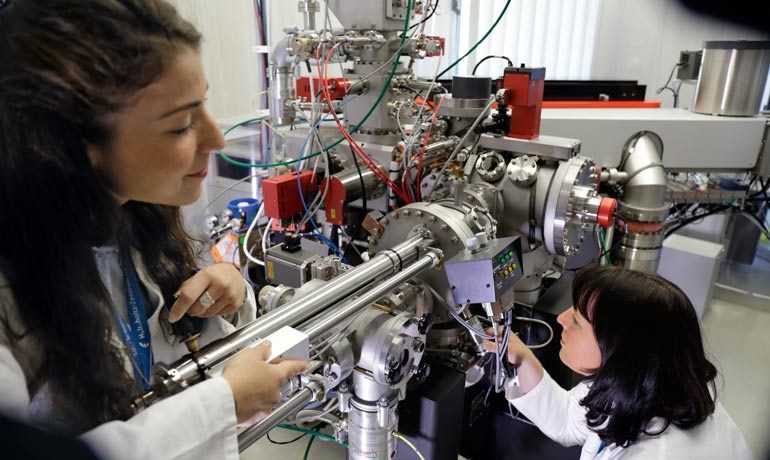
Doch wo kein Wasser ist, können sich diese Kreaturen nicht bewegen – und keine neuen Nahrungsquellen erschließen. Insbesondere mit Luft gefüllte Bodenporen stellen unüberwindbare Hindernisse dar. Und dennoch: Obwohl die Poren oberhalb des Grundwasserspiegels nur teilweise wassergefüllt sind, kommen Bakterien von A nach B. Ihr Trick: Sie nutzen die dünnen Zellfäden (Hyphen) von Pilzen, die im Untergrund dichte Geflechte bilden. „Diese Hyphen kann man sich wie eine Pilzautobahn vorstellen, entlang derer sich Bakterien schnell ausbreiten können“, sagt Lukas Wick, Leiter der Arbeitsgruppe Bioverfügbarkeit am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. „Dabei bewegen sie sich nicht innerhalb der Hyphen, sondern in einem dünnen Wasserfilm, der diese umgibt.“
Unter dem Mikroskop kann man bestens beobachten, wie sich die unter fluoreszierendem Licht hellgrün leuchtenden Bakterien entlang der Pilzhyphen bewegen und in neue Lebensräume vordringen. Über die Zusammensetzung dieser Filme ist wenig bekannt, gewiss ist aber, dass die Bakterien hier auch Nährstoffe finden, die von außen in die dünne Wasserschicht der Hyphen diffundieren. Die Mikroben können dann dem Konzentrationsgefälle folgend entlang der Hyphen bis zur Quelle der Nährstoffe wandern, beispielsweise die Öl- und Benzinreste unter einer alten Tankstelle.
Selbst im Extremfall vollkommener Trockenheit bewährt sich diese Pilzautobahn. Ohne Wasser fallen die Bakterien nämlich in eine Art Winterschlaf, bilden Sporen und können in dieser Form Jahrzehnte, Jahrhunderte, sogar Jahrmillionen überdauern. Stoffwechselprozesse lassen sich nicht mehr nachweisen, was natürlich auch bedeutet, dass sie keine Schadstoffe mehr umsetzen.
Doch jene Pilzhyphen können auch in trockene Bereiche sprießen und dort verharrende Sporen zu neuem Leben erwecken. Unter dem Mikroskop ist deutlich zu sehen, wie das feuchte Pilzgeflecht die kleinen, rundlichen und nur etwa einen Tausendstel Millimeter großen Bakteriensporen erreicht und zu neuem Leben erweckt. Sie strecken sich, wachsen um das Zehnfache an und vermehren sich.
Das Sekundärionen-Massenspektrometer (NanoSIMS) offenbart, wie das vonstatten geht. Mit seiner Hilfe lassen sich stabile Isotope nachweisen: Atomarten eines bestimmten Gewichts, die in der Natur sehr selten vorkommen. Stellt man den Pilzen ein mit diesen Markern versetztes Nährmedium zur Verfügung, lässt sich der Transport dieses Mediums innerhalb der Pilzfäden nachvollziehen. Tatsächlich strömt es durch die Hyphen und – das konnten wir mit Hilfe dieser Methode nachweisen – versorgt die Bakterien über diesen Weg mit Wasser und Nährstoffen.
So ergibt sich also eine Allianz zwischen Pilzen und Bakterien, die sich für die schonende Sanierung von kontaminierten Böden eignen könnte. Heute übliche Verfahren sind technisch ungeheuer aufwändig. Häufig müssen die belasteten Areale großflächig ausgehoben werden und der verschmutzte Boden auf Temperaturen von über 500 Grad Celsius erhitzt werden, um die flüchtigen Schadstoffe auszutreiben. Bei den so genannten Bioremediationsverfahren geht es indes darum, die Natur die Arbeit machen zu lassen.
Was im gut kontrollierten Laborversuch bestens funktioniert, kann in der Natur allerdings durchaus scheitern. So ist die Zusammensetzung organischer Schadstoffe an entsprechenden Standorten meist sehr heterogen. Manche der Substanzen schmecken den Bakterien schlicht nicht, andere sind sogar giftig und bei wieder anderen entstehen beim mikrobiellen Abbau neue Verbindungen, die ihrerseits die Umwelt schädigen. Und: Mikroben können nur organische Schadstoffe verdauen. Schwermetalle etwa lassen sich mit ihrer Hilfe nicht beseitigen.
Ein weiteres Problem: Mikroorganismen sind nicht die schnellsten und brauchen deshalb unsere Unterstützung bei der Arbeit. Der Boden wird dafür zu so genannten Mieten aufgeschüttet, in denen sich die Lebensbedingungen der Mikroorganismen hinsichtlich Temperatur, Sauerstoff- und Wassergehalt optimieren lassen. In ersten Pilotanlagen geht es nun darum, auch darauf zu verzichten und stattdessen die Allianz von Pilzen und Bakterien gezielt vor Ort zu stimulieren. An ehemaligen Militärflugplätzen und Tanklagern stellen sie jetzt ihr Können unter Beweis.
Überforderte Natur
Wie Bakterien die Folgen der Deepwater-Horizon-Katastrophe minderten – ein bisschen jedenfalls
An jedem Tag fließen über 160 000 Liter Öl in den Golf von Mexiko. Das entspricht der Ladung von etwa vier Tanklastwagen. Machen kann man daran nichts, denn die zähe schwarze Flüssigkeit tritt am Meeresboden aus natürlichen Ölquellen aus. Und zwar seit Millionen von Jahren. Rohöl ist hier auch Teil der Nahrungskette hunderter von Bakterien-, Algen- und Pilzarten.
Als am Abend des 20. April 2010 rund 80 Kilometer vor der Küste Louisianas die Bohrplattform Deepwater Horizon explodierte, strömten täglich neun Millionen Liter Rohöl ins Meer. Nach 84 Tagen waren es etwa 760 Millionen Liter – das entspricht der Ladung von fast 20.000 Tanklastwagen. Die Deepwater-Horizon-Explosion führte zur schwersten Katastrophe dieser Art aller Zeiten.
Um die Bildung eines Ölteppichs zu verhindern, wurden etwa 7 Millionen Liter eines Dispersionsmittels versprüht. Das Öl bildete nun riesige Wolken, in denen eine deutliche höhere Bakteriendichte gemessen wurde. Einige der leichter flüchtigen Substanzen verschwanden innerhalb von Tagen, Wochen und Monaten. Ein Grund dafür: Im Golf von Mexiko gibt es bereits ein auf Rohöl spezialisiertes mikrobielles Ökosystem.
Doch allzu hohe Erwartungen wurden enttäuscht. Am Ende lagen die Raten der biologischen Schadensbegrenzung unter den Erwartungen der Experten. Die meisten Schadstoffe blieben viel länger im Wasser als erwartet. So berichtete Max Grünig, Präsident des Ecologic Institute in Washington, dass mehr als sieben Jahre nach der Katastrophe in den Eiern von Pelikanen noch immer Spuren des Öls zu finden seien. Auch sei bei den Delfinen bis heute die Sterblichkeit erhöht – bei gleichzeitig niedrigeren Fortpflanzungsraten.
Von Joachim Schüring


